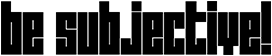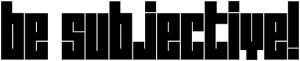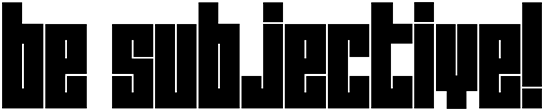Das Hurricane Festival zwischen Bremen und Hamburg ist längt eine Institution in der deutschen Festivallandschaft. Auch in diesem Jahr strömen wieder über 60000 Gäste nach Scheeßel, um Auftritte von musikalischen Giganten wie The Cure, Foo Fighters, oder Die Toten Hosen zu genießen. Die ersten Feierwütigen starten schon am Donnerstag die große Party, mit dabei Bands wie Radio Havana und Montreal. Der nicht ganz so fitte Festivalmensch kriecht hingegen erst am Freitag aus seinem Versteck in die grelle, grelle Sonne. Sonne?
Freitag
Ja, richtig. Sonne. Ein selten gesehener Gast auf dem Eichenring. 2019 soll als das Jahr Geschichte schreiben, in dem das Hurricaneswimteam überflüssig wurde. Diese eröffnen den Festivalfreitag mit Songs wie „Am sichersten seid ihr im Auto“ auf der Hauptbühne – solche Songs machen Sinn bei den sintflutartigen Gewittern der Vorjahre, aber 2019 bei fast 30°C? Wird es im nächsten Jahr also eine neugeformte Schönwetterband geben? Das Hurricanetanteam mit „Am besten ist LSF 50“? Spaß beiseite. Der Auftritt macht auch mit minder korrekten Texten Spaß und bereitet auf alles vor, was an diesem Wochenende noch kommt.
Shame zum Beipiel, die kurzerhand für den erkrankten Sam Fender eingesprungen sind und mit ihrer rotzigen Performance auf voller Länge überzeugen. Schließlich bringen sie alles mit, was wir an England so lieben. Spuren der frühen Editors und Oasis gepaart mit dem ungeschönten Akzent der englischen Arbeiterklasse. Klasse.
Rotzig, das konnten auch Betontod mal, die auf der Hauptbühne alles für ihren Auftritt vorbereiten. Es ist eine dieser Bands, die seit unserer Jugend in unseren Punkerherzen umherschwirren. Leider macht der Wandel auch hier keinen Halt und raue Nummern wie „Kinder des Zorns“ werden von stereotypen Stadion „Ohohohs“ und „Wohohos“ abgelöst, wie wir es in den letzten Jahren bei vielen Bands diesen Genres beobachten konnten – ein besonders großes Beispiel übernimmt an diesem Abend den Headlinerslot. Natürlich ist ein stilistischer Wandel bei einer so langen Bandgeschichte unumgänglich, dennoch bleibt ein bitterer Beigeschmack.
WE ARE ENTER SHIKARI – WE ARE FROM EUROPE!
Anders verlief dieser Wandel bei Enter Shikari. Von ihren Metalcoreanfängen hat sich die Band zu einem Phänomen gewandelt, das sich in keine Genres ordnen lässt. Dementsprechend vielfältig gestaltet sich der Auftritt der Jungs aus England. Harte Riffs, wirre Electroparts und Rou Reynolds wilde Performance (die eine noch wildere Performance der Stagehands, die hinter ihm aufräumen nach sich zieht) machen diesen Auftritt zu einem der erinnerungswürdigsten des Festivals. Was gut ist, denn neben der Musik hatten Enter Shikari vor allem in Bezug auf den Klimawandel eine Menge zu sagen.
Durchatmen und runterkommen kann man im Anschluss bei Cigarettes after Sex, wenn man sich darauf einlässt. Der melancholisch träumerische Sound der Band funktioniert eigentlich in fast allen Lebenslagen – in der prallen Sonne vor buntem, angeheiterten Publikum, wirkt die kunstvolle, nur in schwarz – weiß auf die Monitore übertragene Performance jedoch etwas verloren – leider.
Hätte vielleicht im Zelt besser funktioniert.
Perfekt in die pralle Sonne passen dafür die Leoniden auf der Mountain Stage, weit abseits der beiden riesigen Hauptbühnen, von welcher eine gleich von Papa Roach zerlegt wird. Das können die Indie-Rocker aus Kiel mindestens genauso gut. Die Bereiche vor der kleineren Mountain Stage platzen aus allen Nähten. Die energiegeladenen Live-Auftritte der Leoniden sind schon lange berüchtigt, wodurch sich in den letzten Jahren eine starke Fanbase gebildet hat. Publikum und Band stacheln sich gegenseitig zu Höchstleistungen an. Ein Bild, welches sich an diesem Wochenende vor allem bei den „kleineren“ Künstlern zeigt. Es sind die Auftritte, für die sich spezifische Teile der bunten Masse abspalten, um etwas besonderes abseits der großen Bühnen zu sehen, wodurch die Gigs trotz der gigantischen Umgebung noch immer intim und besonders wirken.
bis zum Falafelstand
und noch viel weiter
Auf der Riverstage übernimmt Bosse, ein Garant für einen gelungenen Festivalauftritt. Der unfassbar sympathische Musiker versprüht gemeinsam mit seiner tollen Band gute Laune – bis zum Falafelstand und noch viel weiter.
Weniger gute Laune, dafür mehr Krach und Pyro gibt es nebenan bei Parkway Drive. Die Band marschiert umringt von Fakelträgern und Securities durchs Publikum auf die Bühne und setzt dort über die Dauer ihres Auftritts im Prinzip alles in Flammen – ist ja noch nicht warm genug. Eher kühl bleibt der restliche Auftritt. Metalcore wie ihn der Duden beschreiben würde – klinisch rein performt. Zahlreiche Circlepits in der Menge bezeugen seine Effizienz.
Wer es lieber bunter mag, geht rüber zu Bilderbuch, welche mit ihren immer neuen, ausgefallenen Bühnenaufbauten und ihrem quietschbunten Kunstpop eh alle überzeugen. Immer. Ist geil. Genau wie Die Toten Hosen. Konstante Headliner. „Bonnie & Clyde“, „Wünsch dir was“, „Liebeslied“ – kennen alle, lieben alle. Funktioniert. Campino und Kollegen nach all den ganzen Jahren noch immer in Höchstform, doch irgendwie fehlt das Neue, der Kitzel, die Aufregung. Die kann man im Anschluss bei den Australiern von Tame Impala suchen, welche die FestivalbesucherInnen mit ihrem psychedelischen Sound einlullen. Super Sound, massiver Nebel und eine beeindruckende Lichtshow bilden den perfekten Abschluss für den ersten Festivaltag. Augen schließen, tanzen, runterkommen.
Samstag
Ganz ohne Nebel, SchnickSchnack und Chichi starten am Samstag Abramowicz auf der Hauptbühne. Sauberer Indierock für verschlafene Festivalgäste. Etwas aufgeregter wird es bei The toten Crackhuren im Kofferraum. Elektronisch, bunt, laut, vulgär. Ponys, Jobcenterfotzen und Ronnys – kein grundlegend wichtiges Thema wird ausgelassen.
Bigger = Better?
Es ist einer dieser Auftritte, den man gern bis zum Schluss anschauen würde, ABER! Nun kommen wir zum essentiellen Problem des Hurricane Festivals. Zu viele Bühnen, zu viele KünsterInnen, zu viele zeitliche Überschneidungen. Klar will man mit einem möglichst großen Line-Up möglichst viele Gäste aus verschiedenen musikalischen Subkulturen anlocken – aber um welchen Preis? Der Festivalgast ist innerlich zerrissen, weil viel zu oft Bands gleichzeitig auftreten, die sich eine große Schnittmenge des Publikums teilen. Müssen es zwingend vier rund um die Uhr besetzte Bühnen sein, die räumlich so weit voneinander entfernt sind, dass selbst der lange Weg von A nach B schmerzhaft viel wichtige Konzertzeit des Musikliebhabers stielt? Oder geht es den Gästen überhaupt nicht mehr um die Musik? Festivals müssen ja mittlerweile Luxus sein. Wer mehr zahlt, bekommt mehr. Das Gelände ist überfüllt mit VIP-Lounges und gewaltigen Aufbauten von Modelabels, Versandhäusern oder Stromanbietern. Das kann man als Gast natürlich alles ignorieren, aber die Zeitüberschneidungen bleiben. Ein zeitlich noch passables Beispiel: The Toten Crackhuren im Kofferraum starten um 12:30 Uhr auf der Riverstage, The Dirty Nil um 13:00 Uhr auf der Mountain Stage (AKA „Am Arsch der Welt Bühne“). Der Weg dorthin dauert, aber es wäre unendlich blöd, The Dirty Nil zu verpassen, also bricht man bereits nach 20 Minuten Spielzeit bei den Toten Crackhuren auf. Weder toll für den Gast, noch für die KünstlerInnen.

The Dirty Nil sind großartig. Richtiger Rock mit Scheißegalattitüde, ganz ohne aufwändige Bühnenshow, Schockelemente oder andere Aufreißer. Die Kanadier machen was sie wollen, wie sie es wollen. Davon brauchen wir viel mehr. Auf Grund der Uhrzeit und der gewählten Bühne finden sich leider nur wenige Gäste im Pit vor der Bühne ein. The Dirty Nil liefern trotzdem eine perfekte Show ab.
Sexual violence doesn’t start and end with rape
It starts in our books and behind our school gates
Men are scared women will laugh in their face
Whereas women are scared it’s their lives men will take (Mother -Idles)
Noch viel mehr Scheißegalattitüde gibt es im Anschluss bei Idles. Dreckiger, ungeschönter Post – Punk (jaja, die Band selbst wehrt sich gegen diesen Begriff) schallt von der Riverstage. Die pinken Pfingstrosen auf dem Backdrop täuschen – nichts an diesem Auftritt ist rosig. Die Performance Joe Talbots wirkt nahezu bedrohlich. Ansagen und Lyrics hingegen wichtig und richtig. So wird sich ausgesprochen für Frauenrechte, Gleichberechtigung, Flüchtlingshilfe und Nächstenliebe. Harte Musik, klare Worte, super Typen!
Noch bunter geht es bei Zebrahead zur Sache. Neben Musikern mit iranischen, italienischen und skandinavischen Wurzeln stehen auch extraterrestriale Geschöpfe auf der Bühne und scheinen bei uns auf der Erde nur eines gelernt zu haben: Bier trinken.
Typisch amerikanischer Punkrock erfüllt den Eichenring. Circle Pits in der Menge wirbeln ordentlich Staub auf. Spätestens jetzt sind alle wach. Ähnlich gut geht es sicher bei Alex Mofa Gang auf der Arsch-der-Welt-Bühne zur Sache, die exakt zeitgleich spielen.
Be more kind.
Der Samstag ist eben der Tag der harten Entscheidungen. Frank Turner and the Sleeping Souls statt Montreal. Ein weiterer dieser kleineren Künstler, mit einer enormen Fanbase, die durch langes, unermüdliches Touren in allen kleinen und großen Städten und kleinen und großen Läden zusammengewachsen ist. Alles auf und abseits der Bühne singt und tanzt. Die Energie und Freude Turners am Live-Spielen ist kaum zu fassen und steckt an. Ein ähnlich guter Typ mit ähnlich guter Fanbase tritt kurz darauf im schattigen Zelt auf. Enno Bunger spielt traurige, schöne und aufbauende deutschsprachige Songs am Keyboard. Eine angenehm ruhige Pause im hektischen Festivaltrubel, doch auch hier muss man sich schnell wieder verabschieden, für die nächste harte Entscheidung.
Flogging Molly auf der Hauptbühne oder Muff Potter am Arsch der Welt? Wirklich, liebes Hurricane?
Flogging Molly sind immer eine sichere Bank für eine gute Zeit, aaaaaber Muff Potter sind nach langer Trennung zurück und haben sich noch immer nicht klar geäußert, was die Zukunft bringen wird, also wird jede Chance genutzt, die Herren live zu sehen. Neue Songs gibt es keine, dafür all die alten Nummern, die wir so lieben. Von „Die Guten“ bis „Den Haag“- perfekt. Es ist einer der wenigen Auftritte, die man bis zum Schluss genießen und aufsaugen kann, denn im Anschluss spielen die 257ers und die braucht man als MusikliebhaberIn so wenig, wie einen Versandhauskatalog auf ‘nem Musikfestival.
Außerdem gilt es, Kraft zu sammeln, für die nächste große Entscheidung. Bloc Party oder La Dispute? Bloc Party sind großartig, wirklich! Aber eine kleine Menge des Publikums hat zum Glück auch ein Herz für die Unterdogs von La Dispute, welche ganz nebenbei mit „Panorama“ eines der vermutlich besten Post-Hardcore Alben diesen Jahrs abgeliefert haben. Dieses funktioniert live außerordentlich gut, wird jedoch von viel zu wenigen Leuten bestaunt.
Auch die Wombats und Pascow gleichzeitig spielen zu lassen ist nicht wirklich fair. Aber von der Arsch-der-Welt Bühne bis zum Zelt ist es unglaublich weit und der Tag war lang, sodass unsere überhitzten Körper auf halber Strecke bei den Wombats halt machen. Fröhlicher Indie-Pop und tanzende Riesenwombats werden vom Publikum dankend angenommen, das Rad wird an dieser Stelle aber nicht neu erfunden…wären Pascow doch nur nicht so weit weg…
Von den Wombats stolpert die Menge direkt weiter zu Annenmaykantereit und ihren Liedern über gescheiterte Liebe und andere Tragödien, die für 1000 Leben reichen. Kritisch muss man eingestehen, dass die thematische Abwechslung fehlt und sich der Grundtenor irgendwo im Zeitgeist gescheiterter Philosophielehramtsstudenten einordnet. Nicht jeder Ü-30 kommt da dran oder steigt dahinter, ABER man muss gestehen, dass das Live schon großes Tennis ist. Headlinerwürdig, betrachtet man die Publikumsreaktionen.
Aber es kommt noch Einiges. Nach Macklemore, der stilistisch völlig aus der Reihe schlägt, beenden Mumford and Sons den Abend auf der Hauptbühne. Riesige Lichtshow, perfekt poppige Songs, kann man machen, aber nur ein paar Minuten, denn auf der Mountain Stage haben die Veranstalter noch die großartigen Decendents versteckt. Hardcore-Punk Legenden die definitiv eine der beiden Hauptbühnen verdient hätten. Eine wird von Mumford and Sons belegt, gut, viele Leute brauchen viel Platz. Die River Stage hingegen wird für Steve Aoki vorbereitet – Die One Man DJ Show mit viel Licht, Video und Feuerwerk und TamTam.
Sonntag – die Stunde der Frauen
Wer die Nase voll hat von Entscheidungen wird auch am Sonntag nicht verschont, denn ca. 80 % der weiblichen Acts werden teilweise simultan auf die ersten Slots des letzten Festivaltags gequetscht. Den Beginn macht Lion. Beth Lowen mit ihrer wunderbar tiefen Stimme spielt in der Mittagshitze vor gefühlt 50 Menschen am Arsch der Welt. Der Auftritt sitzt zum Glück auch ohne große Publikumsbeteiligung.
Bereits 30 Minuten später wartet die österreichische Rapperin Mavi Phoenix auf der River Stage – ein neues, frisches Gesicht mit neuem, frischen Low-Fi Trap auf unseren Bühnen – das zu sehen macht Spaß, doch im Hinterkopf rattert es schon wieder: Skinny Lister (ebenfalls mit Frontfrau) oder Sookee?
Skinny Lister machen live unglaublichen Spaß und hätten die Menge auch zu späterer Stunde begeistern können. Die Entscheidung fällt auf die Berliner Rapperin Sookee, die losgelöst von sämtlichen Hip-Hop-Klischees mit spannenden Gästen wie Säye Skye oder Saskia Lavaux/Alex von Schrottgrenze, einen wahnsinnig starken und sehr wichtigen Auftritt abliefert. Sookee findet starke Worte und den ein oder anderen Witz für die LGBTIQ-Community, für Gleichberechtigung und gegen die ganze Nazischeiße, die all diese Werte gefährdet. Das Publikum hört ihr zu, jubelt und lässt sich trotz allen Ernstes nicht den Spaß an der Musik nehmen. Nebenan ist kurze Zeit später mit Großstadtgeflüster eine weitere Band mit Frontfrau am Start – doch Sookees Auftritt fesselt zu sehr.
Und dann ist sie vorbei, die Stunde der Musikerinnen. Bear’s Den – bärtige Flanellhemdträger klingen genauso, wie es ihr Aussehen vermuten lässt und spielen weichgespülten Hipster-Indie auf der River Stage, während Royal Republic nebenan schon mal die roten Samtanzüge bügeln, für einen gelungenen, spaßigen Auftritt. Royal Republic transportieren keine große Message, aber sorgen für eine gute, unbeschwerte Zeit und brechen (vermutlich) einen Circle Pit-Weltrekord. Rechnung: 3 Leute genügen für ein Circle Pit. 30 also für 10 und 300 für 100 und 3000 für 1000. Demnach befinden sich für der Bühne mindestens 1000 kleine Circle Pitchen. Völlig verwirrt von der knallenden Sonne und all der Mathematik vergisst man, das nebenan fast zeitgleich auch The Streets spielen und feiert ausgelassen zu den Partysongs der adretten Schweden.
Wolfmother übernehmen und sowohl Fans als auch Band scheinen die Abwanderung von Ian Perez zu Xavier Rudd überstanden zu haben. Die neue Besetzung um Andrew Stockdale hat sich eingegroovt und transportiert den einnehmenden Stoner Rock perfekt. „Victorious“, „Woman“ oder „Dimension“ – ihr nennt es, Wolfmother spielen es. Highlight jagt Highlight jagt Highlight. Nicht ganz so überzeugend sind Interpol an diesem Tag. Die Menge ist heißgelaufen und will mehr. Interpol bremsen diese Energie an dieser Stelle gewaltig aus.
Aber es gibt ja Frauen um den Karren wieder aus dem Dreck zu ziehen. Der Auftritt von Christine and the Queens ist vielleicht auf musikalischer Ebene nicht das, was zwingend im Gedächtnis bleibt, aber dafür auf tänzerischer. Eine Performance dieser Art ist auf einem Festival wie dem Hurricane unerwartet und eine ganz wunderbare Abwechslung – gern mehr davon.
Tanning with The Cure.
Und mehr von The Cure. Immer! Den ganzen Tag konnte man beobachten, wie nach und nach das bunte Besucherfeld eingefärbt wurde, von vielen schwarzen Flecken. Tageskartengäste, die augenscheinlich nur wegen dieser einen Band gekommen sind und sich auffällig unauffällig unter die Menge mischen bis es um 19:45 Uhr endlich so weit ist und die Gothic-Wave Ikonen um Robert Smith endlich die Bühne betreten. Im hellen Sonnenschein, ein absurdes Bild. Die Band hat über all die Jahre nichts von ihrem Charme verloren.
Smith mimt noch immer den introvertierten Gothicboy und scheint noch immer nicht zu wissen, wie man mit so viel Ruhm umgeht. Zauberhaft. Die Setlist ist fantastisch, der Sound voll und atmosphärisch – eine Qualität, die ihresgleichen sucht. „From the Edge of the Deep Green Sea“ und „Pictures of You” machen den Anfang, bis zu den großen Hits vergehen über 20 Songs. Das Publikum liebt sie alle.
Jemand, den auch alle lieben, scharrt nebenan schon mit den Hufen, um dem Wochenende die Krone aufzusetzen. Dave Grohl und seine Foo Fighters sind der letzte Act an diesem Sonntag. Der wie immer zu einem Späßchen aufgelegte Dave Grohl bringt die Menge energiegeladen wie eh und je ein letztes Mal in Schwung. Wer kann bei Hits wie „The Pretender“ oder „Learn to fly“ schon stillstehen? Drumsolos, Coverversionen, größenwahnsinnige Ansagen – die Foo Fighters beherrschen das Rock’n’Roll Einmaleins im Schlaf, einerseits ne super Sache, andererseits fehlt hier und da doch eine kleine Überraschung und vielleicht die Bescheidenheit eines Roberts Smiths.
Die letzten Töne von „Everlong“ verhallen und dann war es das, das Hurricane 2019 und lässt die Besucher mit gemischten Gefühlen zurück. Es war ein Festival voller musikalischer Highlights, zu vieler Highlights könnte man meinen. Nagend die Gedanken „Hätte ich mal diese Band angeschaut und diese vielleicht sein gelassen…“ – abseits dessen und der allgemeinen Kritik an diesen riesigen, kommerziellen Festivals mit ihren fragwürdigen Werbepartnern, zu hohen Preisen und zu wenigen weiblichen Künstlerinnen, hat das Hurricane auch eine ganze Menge richtig gemacht.
- Die Securities waren immer aufmerksam und haben trotz der Masse an Besuchern einen klaren Kopf behalten, alles wurde so organisiert, dass selbst während der großen Acts kein unkontrolliertes Gedränge aufkam.
- Plastikmüll – gab es zumindest auf dem Gelände wenig. An den Essensständen gab es nur Papier- und Holzgeschirr/-Besteck und für die Getränkebecher gab es ein Pfandsystem.
- Trinkwasser: So viele gratis Trinkwasserstellen wie auf dem Hurricane gibt es selten, selbst im Pit vor den Bühnen hatten die BesucherInnen die Möglichkeit, sich ihre selbst mitgebrachten Trinkgefäße aufzufüllen. Gerade bei diesen Tempertaturen eine absolute Notwendigkeit.
- Die Versorgung mit Essen und Trinken war bestens gegeben, das Angebot vielfältig. (Die Preise einseitig hoch.)
- Das Line-Up per se.
Galerien (by Thea Drexhage bs! 2019):